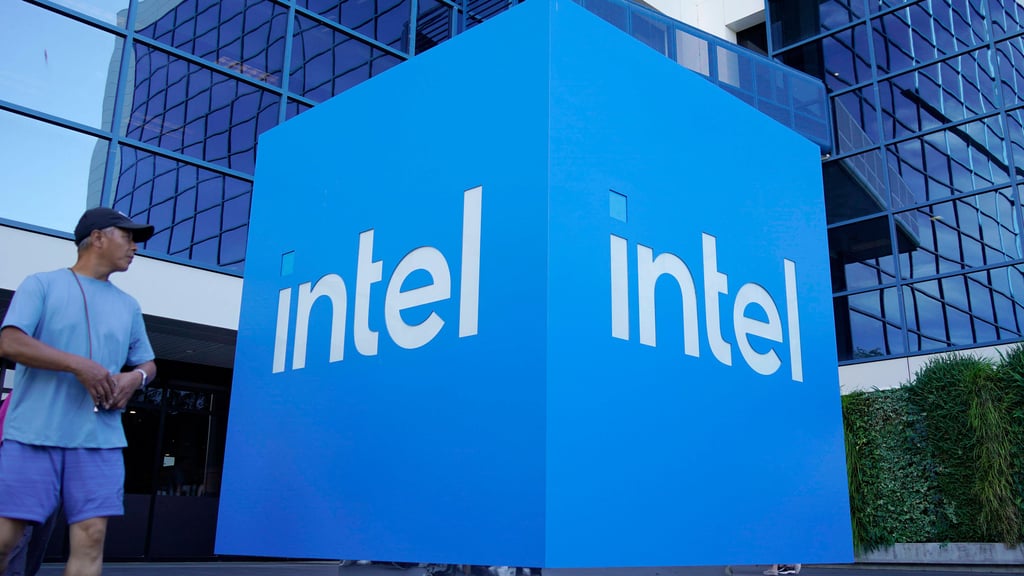Die Bindung schwindet Bundestagswahl 2025: Was Umfragen über die Ergebnisse aussagen
Auch vor der Bundestagswahl 2025 haben Umfragen Konjunktur. Immer wieder werden Zweifel an ihrer Aussagekraft laut. Wie genau sind die Erhebungen?

Mannheim/dpa. - Wer vor einer Wahl der Bevölkerung den politischen Puls messen will, setzt auf Umfragen. Fieberkurven und Säulen zeigen dann, wer sich Hoffnungen machen kann – und wer eher nicht. Auch vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wird keine Woche ohne Umfrageergebnisse vergehen.
„Zunächst muss man feststellen, dass Umfragen niemals Prognosen sein können“, sagt Matthias Jung, Vorstand der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Methodisch sauber könnten Umfragen immer nur die Stimmungslage zum Zeitpunkt der Erhebung aufzeigen.
Lesen Sie auch: Vorgezogene Neuwahl im Februar – Fakten zur Bundestagswahl 2025
„Die Wahlentscheidung fällt inzwischen immer später und immer zeitnäher zum wirklichen Wahltag“, sagt Jung. Das Ganze sei zudem mit einem unvermeidbaren statistischen Fehler behaftet. „Wenige Punkte rauf oder runter bei einer Wahl danach liegen also im normalen Fehlerbereich.“
Wahlforscher: Bindung der Bürger an Parteien wird immer schwächer
Jung sieht die Bindung großer Teile der Wählerschaft an bestimmte Parteien in den vergangenen Jahrzehnten generell schwinden. „Das liegt vor allem auch daran, dass wir heute in einer pragmatischeren und weniger ideologischen Zeit leben. Für viele Menschen sind heutzutage mehr Parteien als früher wählbar“, betont er.
Der Wechsel von einer Partei zur anderen ist für immer mehr Wähler möglich. Dies ermöglicht nicht nur größere Veränderungen der Wahlergebnisse, sondern auch innerhalb der Wochen vor einer Wahl bis hin zum Wahltag.
Lesen Sie auch: Bundestagswahl 2025 - Bis wann ist eine Briefwahl möglich?
Ähnlich sieht es Prof. Dr. Werner Weidenfeld, Direktor des Centrums für angewandte Politikforschung der Universität München. „Die deutlich nachgelassene Bindung an Parteien betrifft die Bindewirkung aller Institutionen – auch etwa der Kirchen und Gewerkschaften“, sagt er.
Wahlen seien nicht mehr so geprägt von Blöcken von Stammwählern, wie dies in früheren Jahrzehnten der Fall war. Das traditionelle Machtkalkül habe seine Stabilität eingebüßt, meint Weidenfeld. „Nur eine grundsätzliche Disposition scheint stabil: die Zukunftsangst.“
Experte: Immer mehr Wähler wechseln ihre Partei
Der Politikwissenschaftler nennt ein Beispiel. „1969 wurde mit Willy Brandt erstmals im Nachkriegsdeutschland ein SPD-Kanzler gewählt. Beobachter sprachen von einer geradezu historischen Veränderung der Stimmergebnisse. In Wirklichkeit hatte die SPD damals 3,4 Prozent gewonnen und die Union 1,5 Prozent verloren.“
Zum Vergleich nehme man die Bundestagswahl 2017. „Da verlor die Union 8,6 Prozent und die SPD 5,2 Prozent. Allgemein wurde dies als Routineergebnis verstanden – obwohl es deutlich größere Wählerbewegungen gegeben hatte.“
Lesen Sie auch: So funktioniert die Bundestagswahl
Das wirke sich auf Umfragen aus. „Sie sind unpräziser geworden. Das hängt an der höheren Beweglichkeit der Stimmungsmilieus“, meint er.
Liegen Umfragen also heute häufiger daneben? „Das hängt von den politischen Umständen ab“, sagt Organisationssoziologe Marcel Schütz, der an den Universitäten Bielefeld und Oldenburg lehrt. Es komme vor, dass sich Wähler stark kurzfristig entschieden oder unehrlich seien bei der Nennung ihrer Präferenz. „Bei der Sachsen-Anhalt-Wahl gab es jüngst einen Mobilisierungseffekt, der nur ungenau in den Prognosen erfasst wurde.“ Er sieht die Zunahme von Umfragen eher skeptisch.
Umfragen nehmen selbst Einfluss auf Wahl-Pläne der Bürger
„Es gibt Vorteile und Nachteile zugleich. Durch immer mehr Umfragen, die fast täglich in Umlauf kommen, werden die Wähler regelrecht konditioniert in ihrem Stimmungsbild“, meint Schütz.
Dies könne zu taktischen Wahlentscheidungen führen – wovon vor allem Parteien mit den höchsten Prozenten profitieren könnten. „Umgekehrt wird es für Institute schwieriger, wenn die Abstände der Parteien schrumpfen.“
Wenn Parteien nahe beieinander lägen, sagt Schütz, könnten schon zwei, drei Prozent über Koalition und Kanzler entscheiden.