Berufsalltag Schönebecks Strafrichter Eike Bruns im Interview: „Die Justiz ist nicht sonderlich nachgiebig“
Wer in Schönebeck und Umgebung gegen das Gesetz verstößt, der hat gute Chancen, Strafrichter Eike Bruns persönlich kennenzulernen. Seit 15 Jahren urteilt der 49-Jährige im Amtsgericht über Straftäter. Volksstimme-Redakteur Paul Schulz hat mit dem Richter über absurde Ausreden, eine vermeintlich lasche Justiz und seinen Arbeitsalltag gesprochen.
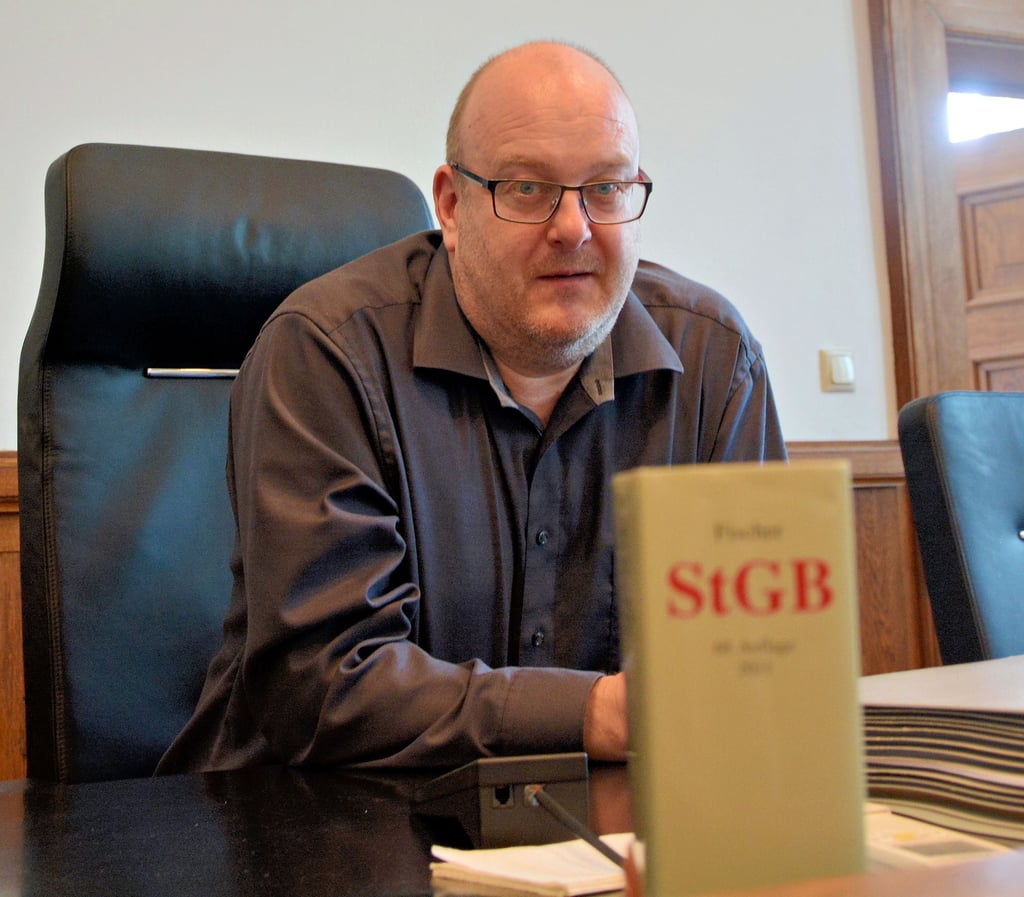
Volksstimme: Herr Bruns, nach 15 Jahren im Amtsgericht haben Sie doch sicher die eine oder andere Anekdote auf Lager. Was hat man Ihnen schon Absurdes auftischen wollen?
Eike Bruns: Ja, da gibt es teilweise schon ganz witzige Geschichten. Ich hatte mal einen Fall, da haben Polizisten eine Ölspur auf einem Feldweg verfolgt. Diese führte sie zu dem Grundstück des Angeklagten, wo sie ein mit Zweigen abgedecktes Auto vorfanden. Sie klingeln und der Angeklagte öffnet – offenkundig deutlich alkoholisiert. Da schien der Fall ja eigentlich klar. Aber in der Verhandlung hatte der Angeklagte eine ganz andere Erklärung dafür. Er habe an einem Schützenfest teilgenommen und als das vorbei war, habe er sich zum Schlafen in sein Auto gelegt. Mitten in der Nacht habe er sich dann noch an einem Busch erleichtert und dann sei plötzlich jemand in sein Auto gesprungen und damit davongefahren. Er sei dann zu Fuß nach Hause und habe seinen verunfallten Wagen auf einer Brücke an dem Feldweg vorgefunden. Dann habe er das Auto nach Hause geschoben. Weil es aber stark danach aussehe, dass er gefahren sei und den Unfall gebaut habe, habe er das Auto notdürftig mit Zweigen getarnt – das war seine Erklärung.
Glaubhafte Geschichte?
Nein. Wir haben das als Schutzbehauptung gewertet.
Gibt es noch andere kreative Ausreden?
Häufig geben auch Angeklagte an, dass sie die jeweilige Tat zwar begangen haben, aber nur, um böse Machenschaften aufzudecken. Sie tun dann so, als wären sie Privatermittler, die beispielsweise das Diebesgut nur gekauft haben, um an eine Diebesbande ranzukommen. Aber solche Aussagen sind in den allermeisten Fällen unglaubwürdig.
Was für Fälle beschäftigen Sie hier am Amtsgericht am häufigsten?
Gottlob haben wir hier nur selten mit schweren Straftaten zu tun. Wir haben vor allem mit Taten der mittleren und leichten Kriminalität zu tun. Ich will das nicht herunterspielen, aber es ist schon ein Unterschied, ob man es mit einem kleinen Ladendieb zu tun hat oder mit jemandem, der schwere menschliche Tragödien angerichtet hat. Dementsprechend ist hier der Umgangston auch etwas lockerer.
Arbeiten Sie deswegen im Schönebecker Amtsgericht? Haben Sie sich das so ausgesucht?
Ja, ich habe während meiner Zeit als Proberichter schon gemerkt, dass ich gerne an einem kleinen Amtsgericht arbeiten möchte. Als Proberichter muss man noch immer und überall aushelfen, wo gerade Bedarf ist. Dabei kommt man viel rum. Erst als Richter auf Lebenszeit ist man gegen den eigenen Willen nicht mehr versetzbar. Mir gefällt das Beschauliche, das fast schon Familiäre. Man kennt dann auch irgendwann alle Anwälte, das finde ich gut.
Und auch die Angeklagten. Es scheint so, als hätten Sie viele davon schon mal vor sich sitzen gehabt.
Das ist richtig. Und wenn man sich in der Stadt über den Weg läuft, dann grüßt man sich auch mal.
Ach wirklich?
Ja, schon. Hier gibt es eigentlich keine große Feindseligkeit oder so etwas. Und der Straftäter, der hier in Schönebeck eine Straftat begeht, der weiß genau, bei wem er landet – nämlich bei mir. Und das ist auch der Unterschied zu einem großen Amtsgericht, wo unterschiedliche Richter arbeiten.
In manchen Verhandlungen appellieren Sie an die Angeklagten, dass diese ihre Aussagen noch mal überdenken sollen. Mitunter gestehen die Angeklagten dann plötzlich doch noch. Ist das eine klassische Strategie?
Also grundsätzlich hat der Angeklagte den Anspruch darauf, seine Sicht der Dinge zu schildern. Da sollte man ihn auch reden lassen. Er darf vor Gericht alles sagen, er darf nur nicht annehmen, dass man ihm alles glaubt. Und manchmal haben die Angeklagten eine falsche Einschätzung darüber, wie die Beweislage ist. Und da bin ich dann der Auffassung, dass man sie darauf hinweisen sollte, dass die Aussagen im Widerspruch zu den Beweisen stehen. Aber es hat immer was für sich, wenn ein Angeklagter glaubhaft geständig ist. Es erspart Zeugen ein Erscheinen vor Gericht. Es erspart möglicherweise traumatisierten Opfern eine Konfrontation mit dem Angeklagten. Es ist aber nicht mehr wie im Mittelalter, wo das Geständnis die Krone des Beweises ist.
Wie meinen Sie das?
Man muss Geständnisse auch durchaus vorsichtig anfassen. Es gibt auch Fälle, in denen sich Angeklagte fälschlich selbst belasten. Deswegen sind wir auch verpflichtet, ein Geständnis auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen. Wir wollen natürlich sichergehen, dass wir den Richtigen vor uns haben. Der Umfang der Prüfung ist dabei natürlich der Schwere der Tat und der zu erwartenden Strafe angepasst. Wir sagen in Deutschland eben: „Lieber einen Schuldigen laufen lassen, als einen Unschuldigen einzusperren.“ Das ist die Richtschnur, nach der wir handeln.
Gibt es Fälle, die Sie besonders gerne bearbeiten oder die Ihnen Spaß bereiten?
Also schnell gehen so Klecker-Sachen wie ein Ladendiebstahl oder sowas. Das ist jetzt aber nicht sonderlich erbaulich. Witzig wird es gelegentlich, wenn wir mit Betrunkenen zu tun haben und die dann Sachen gemacht haben, wo man sich ein gewisses Schmunzeln nicht verkneifen kann.
Können Sie die Motivation mancher Straftaten nachvollziehen?
Ja. Es gibt natürlich so ganz klassische Geschichten. Eifersucht zum Beispiel. Das ist ein Motiv, das eigentlich jeder menschlich nachvollziehen kann. Aber es bleibt eben trotzdem eine Straftat, wenn ich dem Nebenbuhler eine auf die Glocke haue. Es ist menschlich nachvollziehbar, aber trotzdem falsch.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht im Gerichtssaal eine Verhandlung führen?
Dann bereite ich die Verhandlungen vor. Das heißt ich prüfe Akten – zum Beispiel die Anklage der Staatsanwaltschaft. Ich gebe auch dem Angeklagten die Möglichkeit Stellung zu beziehen, damit er zum Beispiel innerhalb einer Frist Beweise vorbringen kann, die ihn entlasten. Ich prüfe, ob überhaupt ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und somit überhaupt ein Verfahren stattfindet.
Und nach einer Verhandlung muss ich meine Urteile auch zu Papier bringen. Es reicht nicht, wenn ich das mündlich in der Verhandlung vortrage, ich muss es auch schriftlich verfassen – und da kommt es auf jeden Satz an. Jeder falsche Satz kann einem als Richter um die Ohren fliegen. Bei komplexen Verfahren kann es vorkommen, dass man mehrere Tage an einer Urteilsbegründung sitzt. Das können bis zu 30, 40 Seiten werden.
Gibt es Gesetze, die Sie persönlich als unnötig, zu streng oder auch zu milde empfinden?
Ich weiß zum Beispiel nicht, ob wir bei unserem Kampf gegen die Drogen auf dem richtigen Wege sind. Das ist eine weltweite Diskussion, die geführt wird. In den USA werden beispielsweise weiche Drogen schon legalisiert. Vielleicht müsste man im Bereich der weichen Drogen auch hier etwas liberalere Konzepte verfolgen. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Der Gesetzgeber hat das so entschieden und dann ist das eben so. Aber trotzdem muss man als Richter auch Gesetze hinterfragen. Dazu verpflichtet uns die Verfassung. Wenn ich jetzt über unsere Strategie zu den weichen Drogen rede, dann ist diese zwar verfassungsgemäß, aber ob sie so sinnvoll ist, ist eine andere Diskussion. Zum Teil werden junge Leute kriminalisiert, die nur mal mit einem Joint aufgegriffen wurden. Da ist die Frage, ob hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Können Sie nach der Arbeit gut abschalten oder nimmt man die Fälle mit nach Hause?
Also ich gehe nicht nach Hause und habe dann schlaflose Nächte. Das funktioniert so nicht. Ein Arzt, dem im Krankenhaus ein Patient verstirbt, der geht auch nach Hause und lebt dann sein Privatleben. Man muss einfach eine professionelle Distanz zur Arbeit, zu den Fällen wahren. Manchmal beschäftigt man sich natürlich trotzdem gedanklich noch damit, beispielsweise wenn es zur Berufung kommt. Dann verfolge ich schon, wie in einem anderen Gericht über einen von mir bearbeiteten Sachverhalt entschieden wird – da reflektiert man schon.
Mitunter monieren Bürger, die Justiz sei zu lasch. Wie sehen Sie das?
Ich denke, dass die Menschen da teilweise ein falsches Bild haben. Wir sind in Deutschland in der guten Lage, dass die Kriminalität seit Jahren rückläufig ist. Deutschland ist ein sehr sicheres Land. Also irgendwas müssen wir in der Justiz schon richtig machen.
Also ist die Justiz nicht zu milde?
Nein, das denke ich nicht. Die Justiz ist nicht sonderlich nachgiebig. Man muss sich auch fragen, was man mit der Justiz erreichen will. Wir haben ein ausdifferenziertes System an Sanktionen. Aber es gibt auch Maßregeln der Bes- serung und Sicherung. Wir haben ein funktionierendes System der Bewährungshilfe, also mit sozialarbeiterischen Ansätzen. Worum es uns geht ist, den Ursachen von Kriminalität entgegenzuwirken und dem Straftäter ein Leben ohne Straftaten zu ermöglichen. Und das machen wir nicht aus Naivität, sondern um weitere Straftaten zu verhindern und um weiteren potenziellen Opfern Leid zu ersparen. Das heißt aber natürlich nicht, dass diese Maßnahmen auch immer fruchten, so dass dann schärfere Sanktionen ergriffen werden müssen. Aber das bloße Wegsperren von Tätern löst keine Probleme und führt nicht zu einer Besserung des Menschen. Ohne sozialarbeiterische Maßnahmen bringt es nichts.
Aber klar: Für die Opfer von Straftaten oder die Hinterbliebenen sind die Strafen immer zu milde. Da habe ich auch Verständnis für. Aber das ist nun die kulturelle Leistung eines Strafprozesses, dass wir sagen: Der Staat verfolgt den privaten Wiedergutmachungsanspruch. Früher hieß es: „Auge um Auge und Zahn um Zahn“. Aber wenn das so gelöst wird, sind wir irgendwann alle blind und zahnlos.




