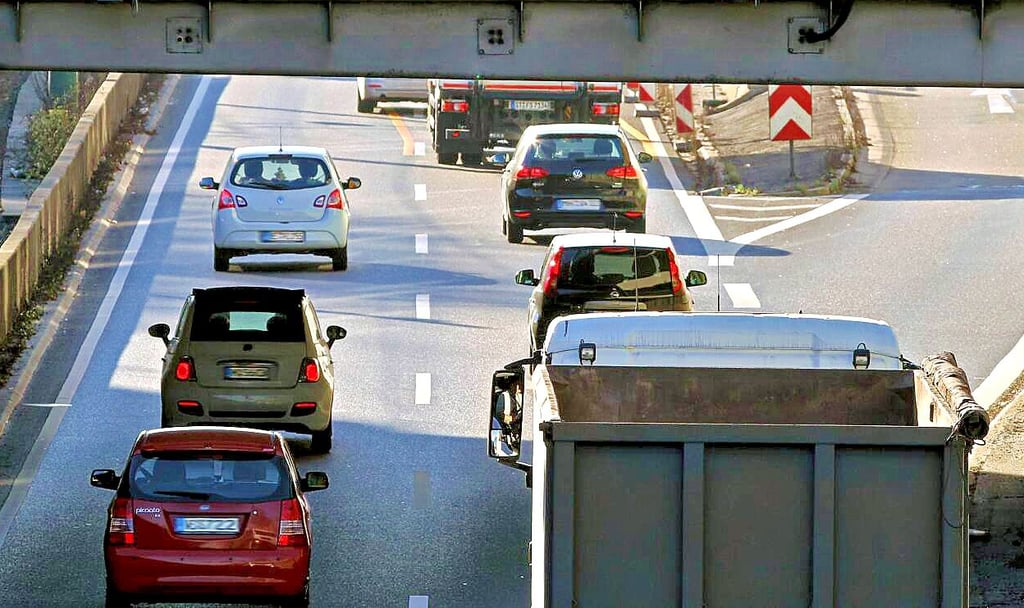Heimatgeschichte Straßenbahn mit einer Pferdestärke
Seit 115 Jahren fährt in Halberstadt die "Elektrische". Doch die Geschichte der Straßenbahn in der Stadt im Harz ist älter.
Halberstadt l Koppeljungen genossen hohes Ansehen unter Gleichaltrigen. Das Wissen darum haben viele Halberstädter über die Jahrzehnte weitergetragen, denn Koppeljungen waren schon 1903 überflüssig geworden. Doch von 1887 bis 1903 waren sie im Einsatz, spannten in der Dominikanerstraße ein zweites Pferd vor jene Waggons, die hinaufgezogen werden mussten zum Fischmarkt und erhielten zum Lohn ein paar Pfennige. Die Jungen brachten dann auch die Pferde wieder zurück in die Dominikanerstraße. Dort befand sich damals eine Reithalle, die 1934 abgerissen wurde und ungefähr da stand, wo sich heute der Vorplatz der Katharinenkirche befindet. Die Halberstädter Pferdestraßenbahn AG nutzte dort einen zweiten Stall, ihr eigentliches Depot lag in der Magdeburger Straße 13.
Die Straßenbahn-Aktiengesellschaft hatten Halberstädter Bürger 1887 gegründet, am 28. Juni startete der Betrieb. In Berlin hatte 1865 die erste Pferdebahn ihre Arbeit aufgenommen, die Halberstädter wollten so etwas ebenfalls haben. Aber die Stadt hatte kein Geld für solch ein Angebot, das auch heftige Proteste auslöste. Vor allem bei der Gewerkschaft der Droschkenkutscher, die ihr eigenes Geschäft bedroht sahen, berichtet Simone Bliemeister. „Die Fahrt mit der Straßenbahn war mit zehn Pfennigen pro Fahrt preiswerter als die Fahrt mit der Droschke, die 50 Pfennige kostete“, sagt die stellvertretende Museumsleiterin. Die dunkelgrünen Wagen mit den Holzbänken und der Petroleumlampe vorn waren auf drei Linien unterwegs, die Droschkenkutscher wurden nicht arbeitslos, sie waren noch bis 1923 im Einsatz. Vom Fischmarkt über den Breiten Weg zum Hauptbahnhof, vom Fischmarkt hinunter zur Voigtei und vom Fischmarkt zum Johannestor juckelte 1887 die Straßenbahn – auf einer Streckenlänge von 3635 Metern.
Über zehn Wagen verfügte die Straßenbahn damals. Sieben geschlossene und drei offene, die in den Sommermonaten zum Einsatz kamen. Wie diese „Cabrios mit einer Pferdestärke“ aussahen, kann man noch bis Ende Mai im Städtischen Museum entdecken. Denn Hans-Joachim Schönitz hat die Waggons von damals liebevoll im Miniaturformat wieder auferstehen lassen, auf jedes Detail großen Wert gelegt. Der 1999 verstorbene Halberstädter hatte einst bei der Straßenbahn gearbeitet und sich intensiv mit der Geschichte dieses Verkehrsmittels befasst. Modelle und Alben mit vielen Bildern rund um die Straßenbahngeschichte in Halberstadt überließ die Witwe dann dem Museum.
Schönitz hat nicht nur die Wagen der Pferdebahn nachgebaut, sondern auch die der „Elektrischen“. Denn 1902 wurden die Weichen neu gestellt, nachdem bereits 1899 erste Überlegungen in diese Richtungen gingen. „Die anfängliche Begeisterung für die Bahn hatte rasch nachgelassen, oft blieben Waggons leer. Und als dann in den 1890er Jahren viele Straßen Kanalisation erhielten, erschwerten die vielen aufgerissenen Straßen den Betrieb zusätzlich“, erklärt Simone Bliemeister.
Die Stadt übernahm die Pferdebahn – am 1. Juli 1902, dem Tag, als der erste Spatenstich für ein Elektrizitätswerk gesetzt wurde. Das entstand in der Gröperstraße – samt neuem, großem Depot. Bis heute dienen die Hallen Straßenbahnwagen als Werkstatt und Garagen.
Ein Modell des Depots findet sich ebenfalls in der kleinen Sonderausstellung zur Straßenbahngeschichte in Halberstadt. Vor dem markanten gelben Gebäude stehen Bahnen aus unterschiedlichen Baujahren. Geschaffen hat das Modell Dieter Janietz, der bis zu seinem Tod im Jahr 2016 leidenschaftlich gern Stadtgeschichte im Modell festhielt.
Mit dem Bau des Depots aber war es nicht getan. Neben dem W-Werk musste auch in ein neues Schienennetz investiert werden sowie in die Verstärkung der Brücken, waren die neuen Waggons doch schwerer als die bisherigen. Am 2. Mai 1903 ratterten die mit Strom betriebenen Straßenbahnen durch die Stadt. Sie waren zwischen Hauptbahnhof, Fischmarkt, Vogtei, Bakenstraße Westendorf, Spiegelstraße und Sternwarte (Klus) unterwegs, auf einem Streckennetz von gut zehn Kilometern Länge und ab 1909 auf sechs Linien. Denn man wollte unbedingt die neu entstandenen und neu entstehenden Wohnviertel im Süden der Stadt mit an das Straßenbahnnetz anbinden.
Mit Beginn des Ersten Weltkrieges wurden einige Linien eingestellt – die Männer zogen in den Krieg und fehlten damit in der Belegschaft – die ohnehin nur männlich war. Erst 1916, als auch wegen der Flugzeugwerke wieder die Nachfrage nach der Beförderung per Straßenbahn stieg, wurden Frauen als Schaffner ausgebildet. 1919 mussten sie dann wieder den heimkehrenden Männern weichen. Die Kriegsfolgen und die ausufernde Inflation ließen den Bahnverkehr bis 1924 auf eine einzige Linie zwischen Magdeburger Straße und Fischmarkt schrumpfen, erst 1925 erholte sich die Wirtschaft, mit ihr die Bahn.
Bis 1945 blieb der Straßenbahnbetrieb relativ stabil, die Bombenangriffe am 8. April zerstörten auch das Schienennetz. Doch bereits am 18. August 1945 wurde der Betrieb zwischen Fischmarkt und Friedhof wieder aufgenommen, die Altstadt hatte weniger Bombentreffer abbekommen. „Im Sommer 1946 war dann das komplette Netz wieder in Betrieb, bis auf die Strecke raus zu den Klusbergen“, sagt Simone Bliemeister.
Ab dem 1. Mai 1951 gehörte die Halberstädter Straßenbahn zum neu gegründeten Volkseigenen Betrieb (VEB) Verkehrsbetriebe Halberstadt, ab 1982 als VEB Städtischer Nahverkehr Halberstadt zum Verkehrskombinat Magdeburg. Nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten gründete sich dann aus diesem Betrieb heraus die Halberstädter Verkehrsgesellschaft HVG. Ihren Sitz hat diese noch immer am Depot in der Gröperstraße 83.